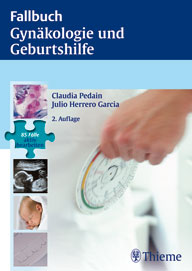OSCEs oder „Objective structured clinical examinations“ sind für viele der Medizinstudenten ein fester Bestandteil des Curriculums und immer wieder ein Grund für Herzrasen, Schweißausbrüche, leichte Übelkeit, also kurz: milde Panikattacken.
Zunächst einmal zur Begriffserklärung. Die OSCEs gehören zum praktischen Teil der medizinischen Ausbildung und sind zwar ein Schreckgespenst, aber im Nachhinein betrachtet doch ein sehr hilfreicher Aspekt der medizinischen Ausbildung im klinischen Studienabschnitt. In einem festen zeitlichen Rahmen werden Fähigkeiten, wie z.B. die gezielte Anamneseerhebung oder klinische Untersuchung, das Legen einer Nadel oder auch die Reanimation geprüft.
 Meist gibt es in jedem wichtigen klinischen Fach ein OSCE, der aus mehreren Stationen mit verschiedensten Aufgabenstellungen besteht, für die man jeweils eine vorgegebene Zeit zum Bearbeiten hat, meist 5-10 Minuten. Die Station ist mit Simulationspatienten oder Puppen, bzw. Simulationsgeräten (z.B. einem Arm zum Blutabnehmen) ausgestattet. Jede Station wird von einem Prüfer überwacht, der auch die Punkte vergibt. Dafür gibt es einen standardisierten Bogen, daher auch das Wörtchen „objective“. Jeder Student hat dieselben Stationen, Prüfer und Bewertungsbögen: Somit ist die Note zumindest einigermaßen fair.
Meist gibt es in jedem wichtigen klinischen Fach ein OSCE, der aus mehreren Stationen mit verschiedensten Aufgabenstellungen besteht, für die man jeweils eine vorgegebene Zeit zum Bearbeiten hat, meist 5-10 Minuten. Die Station ist mit Simulationspatienten oder Puppen, bzw. Simulationsgeräten (z.B. einem Arm zum Blutabnehmen) ausgestattet. Jede Station wird von einem Prüfer überwacht, der auch die Punkte vergibt. Dafür gibt es einen standardisierten Bogen, daher auch das Wörtchen „objective“. Jeder Student hat dieselben Stationen, Prüfer und Bewertungsbögen: Somit ist die Note zumindest einigermaßen fair.
Klingt eigentlich alles wie eine bessere Schnitzeljagd mit spannenden Aufgaben zum Lösen, ist aber meist doch nicht so lustig, da man unter enormem Zeitdruck steht und um eine möglichst hohe Punktzahl zu erzielen, ziemlich genau die gewünschten Angaben auf den Bewertungsbögen abhaken muss.
Wie bereitet man sich nun auf so eine Prüfung vor? Am besten: üben, üben, üben. Die Abläufe der Untersuchung so lange wiederholen, durchführen und aufsagen, bis man sie im Schlaf kann, denn unter Zeitdruck passieren die dümmsten Dinge! In kleinen Gruppen kann man sich gut gegenseitig untersuchen und verbessern. Die meisten Unis stellen auch einige Aufgabenstellungen inklusive Bewertungsbögen zur Verfügung und wenn nicht, fragt in den älteren Semestern nach, ob es Gedächtnisprotokolle gibt!
So lästig und nervenaufreibend die OSCEs auch sind – sie zwingen zu einer intensiven Beschäftigung mit den Basisfähigkeiten, die man während des Studiums erlernen sollte.
Bild: Praisaeng / FreeDigitalPhotos.net

 Sara ist 24 Jahre alt und hat im Sommer 2019 das 10. Semester des Medizinstudiums an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf abgeschlossen. Damit ist sie scheinfrei und plant im nächsten April das 2. Staatsexamen abzulegen. In ihren Beiträgen berichtet sie von den Erfahrungen ihrer vier Famulaturen, die sie im Laufe des klinischen Studienabschnitts absolviert hat.
Sara ist 24 Jahre alt und hat im Sommer 2019 das 10. Semester des Medizinstudiums an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf abgeschlossen. Damit ist sie scheinfrei und plant im nächsten April das 2. Staatsexamen abzulegen. In ihren Beiträgen berichtet sie von den Erfahrungen ihrer vier Famulaturen, die sie im Laufe des klinischen Studienabschnitts absolviert hat. Ich war richtig gespannt darauf die erste natürliche Geburt zu sehen. Doch so schnell ging das nicht, da die meisten Babys bekanntlich nachts zur Welt kommen. Beim ersten Mal überhaupt in einem Operationssaal durfte ich bei einem Kaiserschnitt dabei sein. Und das ging alles soo schnell. Das Baby war nur ein paar Minuten nach dem Hautschnitt geboren und damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Es war einfach so schön und ich konnte meine Tränen nicht zurückhalten. Ab dem zweiten Tag war ich einen Schritt weiter, ich durfte mit an den OP-Tisch. Voller Begeisterung und Motivation stand ich steril an der rechten Seite des Bauches. Zum ersten Mal durfte ich zwei Haken halten und mithelfen. Das war ein sehr schönes Gefühl.
Ich war richtig gespannt darauf die erste natürliche Geburt zu sehen. Doch so schnell ging das nicht, da die meisten Babys bekanntlich nachts zur Welt kommen. Beim ersten Mal überhaupt in einem Operationssaal durfte ich bei einem Kaiserschnitt dabei sein. Und das ging alles soo schnell. Das Baby war nur ein paar Minuten nach dem Hautschnitt geboren und damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Es war einfach so schön und ich konnte meine Tränen nicht zurückhalten. Ab dem zweiten Tag war ich einen Schritt weiter, ich durfte mit an den OP-Tisch. Voller Begeisterung und Motivation stand ich steril an der rechten Seite des Bauches. Zum ersten Mal durfte ich zwei Haken halten und mithelfen. Das war ein sehr schönes Gefühl.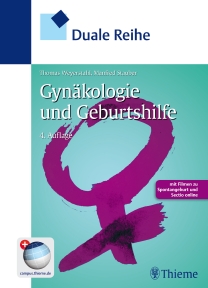 Seit Oktober des letzten Jahres gibt es die Duale Reihe Gynäkologie und Geburtshilfe nun in der 4. Auflage, die einige Neuheiten im Vergleich zum Vorgänger bereit hält.
Seit Oktober des letzten Jahres gibt es die Duale Reihe Gynäkologie und Geburtshilfe nun in der 4. Auflage, die einige Neuheiten im Vergleich zum Vorgänger bereit hält.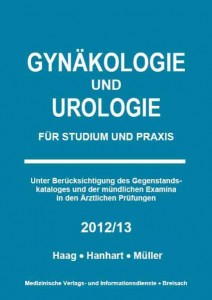 Genau wie für die Chirurgie gibt es auch für die Gynäkologie und Urologie ein Skriptenbuch im Stile des Herolds. Auch dieses Buch wird vom Breisacher Arzt Dr. Markus Müller herausgegeben.
Genau wie für die Chirurgie gibt es auch für die Gynäkologie und Urologie ein Skriptenbuch im Stile des Herolds. Auch dieses Buch wird vom Breisacher Arzt Dr. Markus Müller herausgegeben.