 Nach dem Anatomiekurs oder spätestens im mündlichen Physikum ist es für jeden Medizinstudenten so weit: eine mündliche Prüfung im Fach Anatomie steht an. Genau dafür gibt es seit April ein spezielles Vorbereitungsbuch. Wir haben es probegelesen.
Nach dem Anatomiekurs oder spätestens im mündlichen Physikum ist es für jeden Medizinstudenten so weit: eine mündliche Prüfung im Fach Anatomie steht an. Genau dafür gibt es seit April ein spezielles Vorbereitungsbuch. Wir haben es probegelesen.
Zielgruppe:
Das Buch richtet sich an Medizin- und Zahnmedizinstudenten, denen im Rahmen ihres Anatomiekurses oder im Physikum eine mündliche Prüfung in diesem Fach bevorsteht.
Aufbau / Didaktik:
Das Prüfungsvorbereitungsbuch gliedert sich anhand der einzelnen Organe und Organsysteme in 9 Kapitel. Von den „oberen Extremitäten“ bis zum „Hör- und Gleichgewichtsorgan“ findet man jeweils Fragen zur makroskopischen sowie zur klinischen und topografischen Anatomie. Klinische Bezüge und Übersichtstabellen erleichtern die Wiederholung vor der Prüfung genauso wie Abbildungen aus dem Prometheus. Das komplette Buch ist nach dem Kauf per Code auch über die eRef-Bibliothek von Thieme abzurufen.

 Fast 1500 Seiten widmet die Duale Reihe Innere Medizin dem wichtigsten medizinischen Fachbereich neben der
Fast 1500 Seiten widmet die Duale Reihe Innere Medizin dem wichtigsten medizinischen Fachbereich neben der 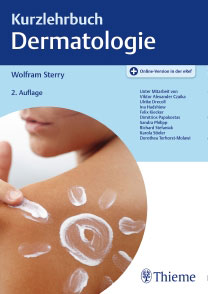 Dermatologie wird von vielen Medizinstudenten relativ schnell im klinischen Studienabschnitt abgehakt. Manchmal reichen aber die Vorlesungen oder das Praktikum nicht aus, um einen guten Überblick über das Fach zu bekommen. Oder man möchte das Präsentierte einfach vertiefen. In solchen Fällen kann das Kurzlehrbuch Dermatologie von Thieme weiterhelfen. Wir haben es probegelesen.
Dermatologie wird von vielen Medizinstudenten relativ schnell im klinischen Studienabschnitt abgehakt. Manchmal reichen aber die Vorlesungen oder das Praktikum nicht aus, um einen guten Überblick über das Fach zu bekommen. Oder man möchte das Präsentierte einfach vertiefen. In solchen Fällen kann das Kurzlehrbuch Dermatologie von Thieme weiterhelfen. Wir haben es probegelesen.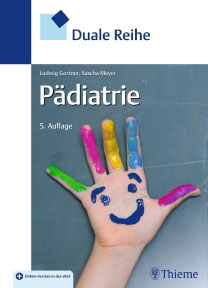 Nach 6 Jahren wurde im Mai dieses Jahres die Duale Reihe Pädiatrie neu aufgelegt. Nachdem auch die
Nach 6 Jahren wurde im Mai dieses Jahres die Duale Reihe Pädiatrie neu aufgelegt. Nachdem auch die  Die Kernspintomographie gehört längst zu den wichtigsten bildgebenden Verfahren. Moderne Geräte, die immer bessere Bilder produzieren und die Möglichkeit einer strahlenlosen Untersuchung machen diese Modalität im klinischen Alltag unverzichtbar. Gerade in der Untersuchung von Gelenkpathologien ist die Magnetresonanztomographie nahezu konkurrenzlos. Für alle Radiologen haben wir uns mal den MR-Atlas.com von Wolfgang Fischer zu Gemüte geführt.
Die Kernspintomographie gehört längst zu den wichtigsten bildgebenden Verfahren. Moderne Geräte, die immer bessere Bilder produzieren und die Möglichkeit einer strahlenlosen Untersuchung machen diese Modalität im klinischen Alltag unverzichtbar. Gerade in der Untersuchung von Gelenkpathologien ist die Magnetresonanztomographie nahezu konkurrenzlos. Für alle Radiologen haben wir uns mal den MR-Atlas.com von Wolfgang Fischer zu Gemüte geführt.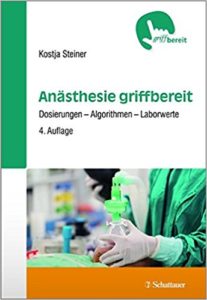 Nachdem wir in letzter Zeit viele „dicke Schinken“ Probe gelesen haben, ist es nun an der Zeit ein extrem praxisrelevantes Buch vorzustellen: „Anästhesie griffbereit“. Das Buch ist erfrischend knapp gehalten und überzeugt mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Nachdem wir in letzter Zeit viele „dicke Schinken“ Probe gelesen haben, ist es nun an der Zeit ein extrem praxisrelevantes Buch vorzustellen: „Anästhesie griffbereit“. Das Buch ist erfrischend knapp gehalten und überzeugt mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Myrièlle ist 19 Jahre alt und hat im letzten Oktober ihr Zahnmedizinstudium an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg begonnen. Damit startet für sie ein neuer Lebensabschnitt in einer neuen Stadt mit neuen Freunden, neuen Tagesabläufen und vielen neuen Eindrücken. In mehreren Beiträgen schildert Myrièlle ihre ersten Erfahrungen vom neuen Leben als Zahni.
Myrièlle ist 19 Jahre alt und hat im letzten Oktober ihr Zahnmedizinstudium an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg begonnen. Damit startet für sie ein neuer Lebensabschnitt in einer neuen Stadt mit neuen Freunden, neuen Tagesabläufen und vielen neuen Eindrücken. In mehreren Beiträgen schildert Myrièlle ihre ersten Erfahrungen vom neuen Leben als Zahni.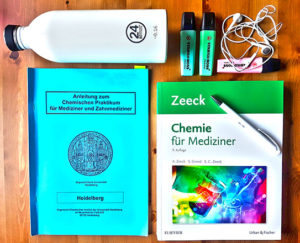 Ich selbst hatte ebenfalls großen Respekt vor dem Fach. Ich hatte Chemie zwar bis kurz vor dem Abitur und immer sehr gute Noten gehabt – dennoch kannte ich einige Studenten und Assistenzärzte, die ihr Studium wegen mehrerer missglückter Chemie-Klausuren verlängern mussten. Aber: es war unerwartet machbar. Gleich zu Beginn des Studiums starten die Vorlesungen, welche einmal die Woche und das gesamte erste Semester abgehalten werden. Nach einigen Wochen beginnt dann auch das Seminar, das für alle Studenten verpflichtend ist. Für jede Woche werden Aufgaben auf Moodle hochgeladen, welche zu erledigen sind und dann gemeinsam in Kleingruppen unter Anleitung eines Chemie-Studenten besprochen werden. Die Lehre beginnt wirklich mit den Grundlagen der Chemie: wie ist ein Molekül aufgebaut? Was sind Van-der-Waals-Kräfte und wie stelle ich korrekt Redox-Reaktionen auf? Besonders hilfreich fand ich die Seminare – in Gruppen von etwa 30 Leuten und im Gespräch mit dem Tutor festigt sich der Stoff einfach besser als im überfüllten Hörsaal. In den ersten Monaten lernten wir also alles Medizinrelevante der Chemie: von den Grundlagen des Atoms über Säure-Base-Reaktionen und Komplexchemie bis hin zu Kohlenhydraten und Proteinen.
Ich selbst hatte ebenfalls großen Respekt vor dem Fach. Ich hatte Chemie zwar bis kurz vor dem Abitur und immer sehr gute Noten gehabt – dennoch kannte ich einige Studenten und Assistenzärzte, die ihr Studium wegen mehrerer missglückter Chemie-Klausuren verlängern mussten. Aber: es war unerwartet machbar. Gleich zu Beginn des Studiums starten die Vorlesungen, welche einmal die Woche und das gesamte erste Semester abgehalten werden. Nach einigen Wochen beginnt dann auch das Seminar, das für alle Studenten verpflichtend ist. Für jede Woche werden Aufgaben auf Moodle hochgeladen, welche zu erledigen sind und dann gemeinsam in Kleingruppen unter Anleitung eines Chemie-Studenten besprochen werden. Die Lehre beginnt wirklich mit den Grundlagen der Chemie: wie ist ein Molekül aufgebaut? Was sind Van-der-Waals-Kräfte und wie stelle ich korrekt Redox-Reaktionen auf? Besonders hilfreich fand ich die Seminare – in Gruppen von etwa 30 Leuten und im Gespräch mit dem Tutor festigt sich der Stoff einfach besser als im überfüllten Hörsaal. In den ersten Monaten lernten wir also alles Medizinrelevante der Chemie: von den Grundlagen des Atoms über Säure-Base-Reaktionen und Komplexchemie bis hin zu Kohlenhydraten und Proteinen.