Die Änderung der Approbationsordnung hat in den letzten Wochen zu viel Verwirrung unter Medizinstudenten geführt. Antworten auf viele Fragen liefert nun die neueste Ausgabe der Marburger Bund Zeitung:
 Wem bleibt das Hammerexamen erspart?
Wem bleibt das Hammerexamen erspart?
Die Studierenden der Humanmedizin, die nach dem 1. Januar 2014 das Praktische Jahr (PJ) beginnen, sind direkt von den Neuregelungen zur Ärztlichen Prüfung betroffen. Die Splittung des Examens in drei Abschnitte wird erstmals im Frühjahr 2014 greifen, sodass es im Jahr 2014 zwei „parallele“ Prüfungstermine im Frühjahr und Herbst gibt: Wer sein PJ im August 2013 beginnt, der muss noch das alte Hammerexamen nach dem PJ meistern. Er hat eine Prüfung, das sogenannte Hammerexamen mit schriftlichem und mündlichem Teil, am Ende des PJ. Derjenige, der danach, also im Mai 2014, beginnt, wird das neue Examen ablegen. Er muss somit den schriftlichen Teil der Ärztlichen Prüfung bereits vor dem PJ erledigen. Fazit: Wer das „Hammerexamen“ umgehen will, darf insbesondere das PJ nicht vor 2014 aufnehmen. Für alle anderen gilt diesbezüglich die alte Approbationsordnung.
Wie sehen die Prüfungen künftig aus?
Die bisherige Zweite Ärztliche Prüfung, das sog. Hammerexamen, wird nicht mehr wie bisher am Ende des PJ abgelegt. Dessen erster Teil, das schriftliche Examen, wird vor das PJ gezogen. Dies wird der neue Zweite Abschnitt der Prüfung. Der mündliche Teil bleibt am Ende des PJ. Dies ist dann der Dritte Abschnitt der Ärztlichen Prüfung.
Der neue Zweite Abschnitt findet im April und Oktober statt. Diese schriftliche Prüfung darf jetzt auch rechnergestützt durchgeführt werden.
Das alte PJ begann jeweils in der zweiten Hälfte der Monate Februar und August. Künftig beginnt es im Mai und November, also ziemlich kurz hinter der schriftlichen Prüfung.
Der dritte neue Abschnitt, also die mündliche Prüfung, findet dann nach neuem Recht nach dem PJ im Mai und Juni oder November und Dezember statt. Es bleiben also drei Monate Zeit, um sich auf die mündliche Prüfung vorzubereiten.
Mehr Mobilität im PJ
Die Studierenden bekommen die Wahl, ihr PJ entweder in den Universitätskrankenhäusern der Heimatuniversität oder in anderen Universitätskrankenhäusern oder Lehrkrankenhäusern anderer Universitäten zu absolvieren, sofern dort genügend Plätze vorhanden sind. Sie bleiben aus Sicht des Medizinischen Fakultätentages (MFT) bei ihrer Heimatuniversität immatrikuliert und absolvieren dort den Dritten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung.
Für die Möglichkeit, einen Teilabschnitt des PJ (maximal acht Wochen) in geeigneten ambulanten Einrichtungen oder Lehrpraxen abzuleisten, ist ein entsprechender Vertrag mit der Uni und das Einvernehmen der zuständigen Gesundheitsbehörde erforderlich. Im Wahlfach Allgemeinmedizin wird die Ausbildung während des gesamten PJ in einer allgemeinmedizinischen Lehrpraxis absolviert.
In jedem Falle ist ein PJ-Logbuch nun vorgeschrieben. Das Logbuch der jeweiligen Universität des Lehrkrankenhauses (und nicht der Heimatuniversität) ist bindend. Dies gilt für alle Einrichtungen, also nicht nur für Lehrkrankenhäuser, sondern auch für Lehrpraxen und ab 1. April 2013.
Mehr Teilzeit möglich
Bereits mit Verkündung im Bundesgesetzblatt ist es möglich geworden, das PJ in Studienteilzeit zu erbringen. Bei einem hälftigen Teilzeitmodell verlängert sich das PJ auf zwei Jahre. Wie dies bei 75-prozentiger Teilzeit aussieht, ist mit dem jeweiligen Landesprüfungsamt zu klären.
 Mehr erlaubte Fehltage
Mehr erlaubte Fehltage
Die Zahl an erlaubten Fehltagen während des PJs ist von 20 auf 30 erhöht worden. Davon dürfen maximal 20 Fehltage in einem Tertial liegen. Dies gilt seit Verkündung der Verordnung – also seit dem 23. Juli 2012. Eine Übergangsregelung für jene, die zurzeit im PJ sind, gibt es zumindest bislang nicht.
Deckel auf PJ-Entschädigung
Per Verordnung von oben wurde nun festgelegt, dass die Geld- oder Sachleistungen den Bedarf für Auszubildende nach § 13 Abs.1 Nummer 2 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes nicht überschreiten dürfen. Als monatlicher Bedarf gelten demnach zurzeit für Auszubildende an Hochschulen 373 Euro monatlich. Ab 1. April 2013 sollen Lehrkrankenhäuser nicht mehr einen höheren Betrag zahlen dürfen. Bereits jetzt zahlen aber einige Lehrkrankenhäuser eine Aufwandspauschale, die weit über diesem Satz liegt. Offensichtlich soll dies gekappt werden. Fest steht: Diese Obergrenze macht das Praktische Jahr nicht besser, aber an manchen Kliniken billiger.
Mehr PJ-Plätze in der Allgemeinmedizin
Bis Oktober 2015 müssen zehn Prozent, bis Oktober 2017 zwanzig Prozent aller Studierenden an der jeweiligen Universität ihr Wahltertial in der Allgemeinmedizin machen können. Die Medizinischen Fakultäten müssen dafür eine genügend große Zahl an Plätzen zur Verfügung stellen. Ab Oktober 2019 muss jeder Studierende, der sein Wahltertial in der Allgemeinmedizin machen will, dies auch können. Interessant also für alle, die sich vorstellen können später einmal in der Allgemeinmedizin zu arbeiten, egal ob sie Arbeit in einer Großstadt oder auf dem Land suchen.
Blockpraktikum in der Allgemeinmedizin
Künftig muss das Blockpraktikum in der Allgemeinmedizin mindestens zwei Wochen dauern. Nach bisherigen Vorgaben konnte die Länge aller Blockpraktika zwischen ein bis sechs Wochen variieren. Die Verpflichtung auf ein zweiwöchiges Blockpraktikum in der Allgemeinmedizin gilt ab 1. Oktober 2013, dies bedeutet nach Einschätzung des MFT, dass die Universitäten das zweiwöchige Blockpraktikum in der Allgemeinmedizin erst ab dem 1. Oktober 2013 anbieten müssen. Es sei Zugangsvoraussetzung für das neue PJ. Wer somit im Frühjahr 2013 nach altem Recht noch ins PJ geht, muss nach Einschätzung des MFT lediglich ein einwöchiges Blockpraktikum in der Allgemeinmedizin nachweisen. Alle, die dagegen im Frühjahr 2014 nach neuem Recht die Zulassung beantragen, müssen die Absolvierung eines zweiwöchigen Blockpraktikums in der Allgemeinmedizin nachweisen.
Famulatur in der hausärztlichen Versorgung
Ab Oktober 2013 müssen Studierende einen Monat ihrer viermonatigen Famulatur in einer Einrichtung der hausärztlichen Versorgung ableisten. Der Kreis der Hausärzte ist dabei nicht auf Allgemeinmediziner beschränkt. Vielmehr zählt der Gesetzgeber weiterhin dazu:
– Kinderärzte
– Internisten ohne Schwerpunktbezeichnung, die die Teilnahme an der hausärztlichen Versorgung gewählt haben, sowie
– Ärzte, die nach § 95a Abs. 4 und 5 Satz 1 SGB V in das Arztregister eingetragen sind, und
– Ärzte, die am 31. Dezember 2000 an der hausärztlichen Versorgung teilgenommen haben.
Der Teufel steckt im Detail – und zwar in den Übergangsregelungen.
Querschnittsbereich Schmerzmedizin
Den bisherigen 13 Querschnittsbereichen wird die „Schmerzmedizin“ als Nummer 14 hinzugefügt. Jeder, der sich ab Oktober 2016 zum Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung anmeldet, muss Schmerzmedizin als Querschnittsbereich nachweisen können. Dies werden zumeist Studierende sein, die im Oktober 2011 das Studium aufgenommen haben. Bei Zeitverzögerungen trifft die neue Nachweispflicht nach Einschätzung des MFT aber auch Studierende, die das Studium bereits vor Oktober 2011 aufgenommen haben. Mehr Stunden sind für die Querschnittsbereiche jedoch nicht vorgesehen, sodass die Fakultäten bestehende Stundenkontingente wohl umorganisieren werden.
Im ursprünglichen Referentenentwurf war noch ein Querschnittsbereich 13 „Palliativ- und Schmerzmedizin“ geplant. Dies wurde auf Anregung der angesprochenen Fachgesellschaften und des Bundesrates verändert. Da die „Schmerzbehandlung“ bereits nach geltendem Recht Teil des Prüfungsstoffes im neuen Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung ist, dient nach Ansicht des Bundesrates die Ergänzung der Klarstellung, dass Schmerzmedizin auch über die Versorgung Schwerstkranker und Sterbender hinaus Gegenstand der ärztlichen Ausbildung ist.
Wesen statt Pflege
Nach Auffassung des Bundesrates stellt der öffentliche Gesundheitsdienst neben der ambulanten und stationären Versorgung die dritte Säule der medizinischen Versorgung dar. Daher sollten die Studierenden während des Medizinstudiums auch ausreichende Kenntnisse über das öffentliche Gesundheitswesen erlangen.
 Aus diesem Grunde wurde die Bezeichnung des Querschnittsbereich 3 „Öffentliche Gesundheitspflege“ durch die Bezeichnung „Öffentliches Gesundheitswesen“ ersetzt. Dazu gehören Kenntnisse über die Schwerpunktbereiche des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Hierzu zählt der Infektionsschutz (einschließlich Hygiene und Krankenhaushygiene), der umweltbezogene Gesundheitsschutz, der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst (einschließlich der Mundgesundheit), die Sozialpsychiatrie, die sozialmedizinische Begutachtung sowie die Gesundheitsberichterstattung und das Wissen über die sozialen Sicherungssysteme in Deutschland, also die Kranken, Renten, Arbeitslosen und Pflegeversicherung.
Aus diesem Grunde wurde die Bezeichnung des Querschnittsbereich 3 „Öffentliche Gesundheitspflege“ durch die Bezeichnung „Öffentliches Gesundheitswesen“ ersetzt. Dazu gehören Kenntnisse über die Schwerpunktbereiche des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Hierzu zählt der Infektionsschutz (einschließlich Hygiene und Krankenhaushygiene), der umweltbezogene Gesundheitsschutz, der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst (einschließlich der Mundgesundheit), die Sozialpsychiatrie, die sozialmedizinische Begutachtung sowie die Gesundheitsberichterstattung und das Wissen über die sozialen Sicherungssysteme in Deutschland, also die Kranken, Renten, Arbeitslosen und Pflegeversicherung.
Nun müssen Ärzte, die in diesem Bereich arbeiten, nur noch angemessen bezahlt werden, wofür der MB schon seit geraumer Zeit kämpft. Eine Umbenennung des Querschnittsbereichs allein reicht nicht aus.
Jetzt Prüfungsstoff: Gesprächsführung
Gesichtspunkte der ärztlichen Gesprächsführung sind ab sofort Gegenstand der Ausbildung. Dies ist somit sofort Gegenstand des alten Zweiten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung, und damit nach Ansicht des MFT auch Teil des mündlichen und schriftlichen Teils der Prüfung nach neuem Recht.
Ab dem 1. Januar 2014 gilt laut neuer Approbationsordnung, dass die Gesichtspunkte der ärztlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten in der ärztlichen Gesprächsführung lediglich im Dritten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung geprüft werden.
Praktikum der Krankenpflege
Pflegepraktika bzw. Arbeitszeiten in „Einrichtungen der Rehabilitation mit erheblichem Pflegeaufwand“ werden als Pflegepraktika gemäß § 6 der Ärztlichen Approbationsordnung anerkannt. Wer einen Bundesfreiwilligen- und Jugendfreiwilligendienst in der Krankenpflege absolviert hat, kann dies ab sofort auf das Krankenpflegepraktikum anrechnen. Als Krankenpflegepraktikum werden der Rettungsassistent, Altenpfleger, Altenpflegehelfer (wenn die Ausbildung mindestens ein Jahr gedauert hat) oder die Hebamme/Geburtshelferin anerkannt.
Quelle: Marburger Bund Zeitung, Ausgabe 11, 3. August 2012
Bilder: dream designs & cooldesign / FreeDigitalPhotos.net
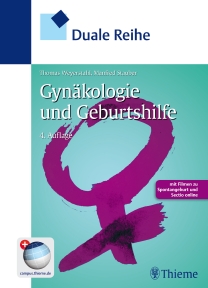 Seit Oktober des letzten Jahres gibt es die Duale Reihe Gynäkologie und Geburtshilfe nun in der 4. Auflage, die einige Neuheiten im Vergleich zum Vorgänger bereit hält.
Seit Oktober des letzten Jahres gibt es die Duale Reihe Gynäkologie und Geburtshilfe nun in der 4. Auflage, die einige Neuheiten im Vergleich zum Vorgänger bereit hält.
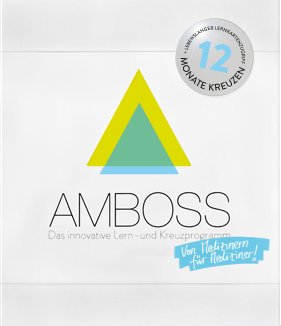 Dabei handelt es sich um ein Programm, das über das Internet verfügbar ist und alle Inhalte liefert, die es für die Examensvorbereitung braucht. Das heißt, dass es sich dabei nicht nur um ein Kreuzprogramm wie bei Thiemen Examen Online handelt, sondern es ebenfalls die Möglichkeit gibt aus sogenannten „Lernkarten“, die skriptartige aufgebaut sind, zu lernen. Das kann man entweder je nach Thema und eigenem Lernplan tun oder praktischerweise nach einem angepassten 100-Tage-Plan, der einem vorgibt, welche Lernkarten (also Themen) man wann lernen sollte und zusätzlich eine Fragesession mit 40-90 Fragen vorgibt, die das Tagesprogramm abrundet. Der Lernplan orientiert sich dabei grob an dem Thieme-100-Tage-Plan und beginnt ebenfalls mit Innere Medizin. Ab Tag 86 bekommt man Zeit für Wiederholungen und dafür die letzten 2 Examina in Echtzeit zu bearbeiten, da diese beim täglichen Kreuzen extra außen vor gelassen werden.
Dabei handelt es sich um ein Programm, das über das Internet verfügbar ist und alle Inhalte liefert, die es für die Examensvorbereitung braucht. Das heißt, dass es sich dabei nicht nur um ein Kreuzprogramm wie bei Thiemen Examen Online handelt, sondern es ebenfalls die Möglichkeit gibt aus sogenannten „Lernkarten“, die skriptartige aufgebaut sind, zu lernen. Das kann man entweder je nach Thema und eigenem Lernplan tun oder praktischerweise nach einem angepassten 100-Tage-Plan, der einem vorgibt, welche Lernkarten (also Themen) man wann lernen sollte und zusätzlich eine Fragesession mit 40-90 Fragen vorgibt, die das Tagesprogramm abrundet. Der Lernplan orientiert sich dabei grob an dem Thieme-100-Tage-Plan und beginnt ebenfalls mit Innere Medizin. Ab Tag 86 bekommt man Zeit für Wiederholungen und dafür die letzten 2 Examina in Echtzeit zu bearbeiten, da diese beim täglichen Kreuzen extra außen vor gelassen werden.
 Zuerst einmal sollte man sich fragen, was man mit der Doktorarbeit überhaupt erreichen möchte. Manchen geht es eigentlich nur um die zwei Buchstaben vor dem Nachnamen. Manche andere möchten sich mit der Arbeit eine gute Grundlage für den späteren Berufsweg schaffen, weil sie zum Beispiel eine universitäre Laufbahn einschlagen möchten oder ihre zukunft in der Forschung sehen.
Zuerst einmal sollte man sich fragen, was man mit der Doktorarbeit überhaupt erreichen möchte. Manchen geht es eigentlich nur um die zwei Buchstaben vor dem Nachnamen. Manche andere möchten sich mit der Arbeit eine gute Grundlage für den späteren Berufsweg schaffen, weil sie zum Beispiel eine universitäre Laufbahn einschlagen möchten oder ihre zukunft in der Forschung sehen. Wem bleibt das Hammerexamen erspart?
Wem bleibt das Hammerexamen erspart? Mehr erlaubte Fehltage
Mehr erlaubte Fehltage Aus diesem Grunde wurde die Bezeichnung des Querschnittsbereich 3 „Öffentliche Gesundheitspflege“ durch die Bezeichnung „Öffentliches Gesundheitswesen“ ersetzt. Dazu gehören Kenntnisse über die Schwerpunktbereiche des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Hierzu zählt der Infektionsschutz (einschließlich Hygiene und Krankenhaushygiene), der umweltbezogene Gesundheitsschutz, der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst (einschließlich der Mundgesundheit), die Sozialpsychiatrie, die sozialmedizinische Begutachtung sowie die Gesundheitsberichterstattung und das Wissen über die sozialen Sicherungssysteme in Deutschland, also die Kranken, Renten, Arbeitslosen und Pflegeversicherung.
Aus diesem Grunde wurde die Bezeichnung des Querschnittsbereich 3 „Öffentliche Gesundheitspflege“ durch die Bezeichnung „Öffentliches Gesundheitswesen“ ersetzt. Dazu gehören Kenntnisse über die Schwerpunktbereiche des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Hierzu zählt der Infektionsschutz (einschließlich Hygiene und Krankenhaushygiene), der umweltbezogene Gesundheitsschutz, der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst (einschließlich der Mundgesundheit), die Sozialpsychiatrie, die sozialmedizinische Begutachtung sowie die Gesundheitsberichterstattung und das Wissen über die sozialen Sicherungssysteme in Deutschland, also die Kranken, Renten, Arbeitslosen und Pflegeversicherung.