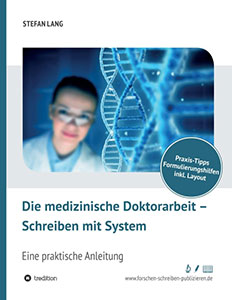 Teil des Studiums ist sie nicht, trotzdem gehört sie für viele Medizinstudenten dazu: Die Doktorarbeit. Wenn man endlich die passende Arbeit gefunden hat und durch wissenschaftliche Methoden zu adäquaten Ergebnissen gekommen ist, sollte nach der Auswertung der finale Schritt folgen: Das Schreiben der Doktorarbeit. Das Buch „Die medizinische Doktorarbeit – Schreiben mit System“ gibt Tipps und Anleitungen wie man ohne große Hindernisse auch diese Hürde meistert. Wir haben uns das Buch mal genauer angesehen.
Teil des Studiums ist sie nicht, trotzdem gehört sie für viele Medizinstudenten dazu: Die Doktorarbeit. Wenn man endlich die passende Arbeit gefunden hat und durch wissenschaftliche Methoden zu adäquaten Ergebnissen gekommen ist, sollte nach der Auswertung der finale Schritt folgen: Das Schreiben der Doktorarbeit. Das Buch „Die medizinische Doktorarbeit – Schreiben mit System“ gibt Tipps und Anleitungen wie man ohne große Hindernisse auch diese Hürde meistert. Wir haben uns das Buch mal genauer angesehen.
Zielgruppe
Das Buch richtet sich an Medizin- und Zahnmedizinstudenten oder Ärzte, die eine medizinische Doktorarbeit schreiben möchten.
Aufbau / Didaktik
Gegliedert ist das Buch in insgesamt acht Kapitel (Das Projekt Doktorarbeit; Die Vorbereitung; Das Konzept der Doktorarbeit; Die Gliederung; Wissenschaftliches Schreiben; Die Überarbeitung; Layout; Am Ziel), die sich jeweils in mehrere Unterkapitel einteilen. Im anschließenden Anhang erfährt man kurz und prägnant, welche Details in „Material und Methoden“ vorkommen sollten und es werden Formulierungshilfen für die vier Teile einer Promotionsschrift (Einleitung, Material und Methoden, Ergebnisse, Diskussion) gegeben. Das Glossar am Ende des Buches enthält wichtige Begriffe aus dem Wissenschafts- und Promotionsjargon. Immer wieder finden sich sinnvolle Praxis-Tipps, die einem den Ablauf und die Systematik des Schreibens verdeutlichen. Die 26 Abbildungen sind wie der Rest des Buches in Schwarz-Weiß gehalten und setzen sich aus passenden Tabellen, Diagrammen oder Grafiken zusammen.
Rezension: „Die medizinische Doktorarbeit – Schreiben mit System“ weiterlesen

 Sara ist 24 Jahre alt und hat im Sommer 2019 das 10. Semester des Medizinstudiums an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf abgeschlossen. Damit ist sie scheinfrei und plant im nächsten April das 2. Staatsexamen abzulegen. In ihren Beiträgen berichtet sie von den Erfahrungen ihrer vier Famulaturen, die sie im Laufe des klinischen Studienabschnitts absolviert hat.
Sara ist 24 Jahre alt und hat im Sommer 2019 das 10. Semester des Medizinstudiums an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf abgeschlossen. Damit ist sie scheinfrei und plant im nächsten April das 2. Staatsexamen abzulegen. In ihren Beiträgen berichtet sie von den Erfahrungen ihrer vier Famulaturen, die sie im Laufe des klinischen Studienabschnitts absolviert hat. Ich habe viele Eltern erlebt, die Impfungen sehr skeptisch begegneten und bei denen musste der Arzt dann wirklich wahre Überzeugungsarbeit leisten, um die Errungenschaften der vielen tollen Impfmöglichkeiten der heutigen Zeit zu erklären. Da Eltern, die ihre Kinder nicht impfen lassen, nicht nur die eigenen, sondern vor allem auch andere Kinder gefährden, kann ich natürlich verstehen, weshalb beispielsweise Kindergärten und Schulen in den USA keine ungeimpften Kinder aufnehmen.
Ich habe viele Eltern erlebt, die Impfungen sehr skeptisch begegneten und bei denen musste der Arzt dann wirklich wahre Überzeugungsarbeit leisten, um die Errungenschaften der vielen tollen Impfmöglichkeiten der heutigen Zeit zu erklären. Da Eltern, die ihre Kinder nicht impfen lassen, nicht nur die eigenen, sondern vor allem auch andere Kinder gefährden, kann ich natürlich verstehen, weshalb beispielsweise Kindergärten und Schulen in den USA keine ungeimpften Kinder aufnehmen. Angelina Bockelbrink ist promovierte Medizinerin, Epidemiologin, Dozentin und Autorin. Sie hat viele Jahre in der universitären Wissenschaft gearbeitet, gelehrt und Doktoranden betreut. Als ganzheitlicher Wissenschaftscoach unterstützt und begleitet sie MedizinerInnen beim Einstieg ins wissenschaftliche Arbeiten und Schreiben.
Angelina Bockelbrink ist promovierte Medizinerin, Epidemiologin, Dozentin und Autorin. Sie hat viele Jahre in der universitären Wissenschaft gearbeitet, gelehrt und Doktoranden betreut. Als ganzheitlicher Wissenschaftscoach unterstützt und begleitet sie MedizinerInnen beim Einstieg ins wissenschaftliche Arbeiten und Schreiben. Die Anmeldung einer Promotion ist meist nicht von Beginn an notwendig. Inzwischen gibt es jedoch an einigen Hochschulen Bestrebungen alle begonnenen Doktorarbeiten zu erfassen. Bislang geschieht das nicht systematisch, was bedeutet, dass man zwar sehr gut weiß, wie viele Doktortitel tatsächlich vergeben werden, aber keinen Überblick hat wie viele Doktorarbeiten in einer Fakultät begonnen und möglicherweise wieder abgebrochen werden.
Die Anmeldung einer Promotion ist meist nicht von Beginn an notwendig. Inzwischen gibt es jedoch an einigen Hochschulen Bestrebungen alle begonnenen Doktorarbeiten zu erfassen. Bislang geschieht das nicht systematisch, was bedeutet, dass man zwar sehr gut weiß, wie viele Doktortitel tatsächlich vergeben werden, aber keinen Überblick hat wie viele Doktorarbeiten in einer Fakultät begonnen und möglicherweise wieder abgebrochen werden.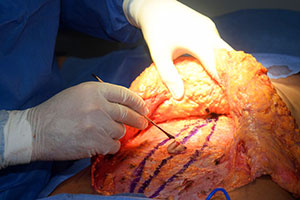 Der ständige Drang, dass alles frisch und jung aussehen muss, hat sich durch Instagram und Co. (leider) längst auch auf die „normale“ Bevölkerung ausgebreitet und wir können nur hoffen, dass hier in Deutschland nicht auch bald immer mehr Brustvergrößerungen zum 18. Geburtstag geschenkt werden, wie man das aus den USA kennt. Die zwei Wochen empfand ich als ausreichend, ich habe einen Einblick in das Fach gewonnen und hatte eine Menge Spaß mit den netten Praxismitarbeitern. Man sieht schnell, dass die Operationen immer auch mit Komplikationen verbunden sein können und man deshalb vorher unbedingt abwägen sollte, ob man bereit ist für die Schönheit (neben der hohen wirklichen Kosten) den Preis der Schmerzen und möglicher Komplikationen zu zahlen.
Der ständige Drang, dass alles frisch und jung aussehen muss, hat sich durch Instagram und Co. (leider) längst auch auf die „normale“ Bevölkerung ausgebreitet und wir können nur hoffen, dass hier in Deutschland nicht auch bald immer mehr Brustvergrößerungen zum 18. Geburtstag geschenkt werden, wie man das aus den USA kennt. Die zwei Wochen empfand ich als ausreichend, ich habe einen Einblick in das Fach gewonnen und hatte eine Menge Spaß mit den netten Praxismitarbeitern. Man sieht schnell, dass die Operationen immer auch mit Komplikationen verbunden sein können und man deshalb vorher unbedingt abwägen sollte, ob man bereit ist für die Schönheit (neben der hohen wirklichen Kosten) den Preis der Schmerzen und möglicher Komplikationen zu zahlen. Solange es in Deutschland noch keine anderslautenden Regelungen gibt, führt der einzige Weg zu einem „Dr. med.“ tatsächlich über die Doktorarbeit. Im engeren Sinne erforderlich ist der Doktortitel allerdings nicht. Mit der Approbation hat man alle erforderlichen Erlaubnisse sich zu jedem gewünschten Facharzt weiterzubilden, klinisch zu arbeiten oder auch eine eigene Praxis zu führen. Wer eine Tätigkeit in der Industrie anstrebt, wird mit einem Doktortitel vor allem finanzielle Vorteile erreichen können. Voraussetzung ist er allerdings auch hier nicht.
Solange es in Deutschland noch keine anderslautenden Regelungen gibt, führt der einzige Weg zu einem „Dr. med.“ tatsächlich über die Doktorarbeit. Im engeren Sinne erforderlich ist der Doktortitel allerdings nicht. Mit der Approbation hat man alle erforderlichen Erlaubnisse sich zu jedem gewünschten Facharzt weiterzubilden, klinisch zu arbeiten oder auch eine eigene Praxis zu führen. Wer eine Tätigkeit in der Industrie anstrebt, wird mit einem Doktortitel vor allem finanzielle Vorteile erreichen können. Voraussetzung ist er allerdings auch hier nicht. Ich war richtig gespannt darauf die erste natürliche Geburt zu sehen. Doch so schnell ging das nicht, da die meisten Babys bekanntlich nachts zur Welt kommen. Beim ersten Mal überhaupt in einem Operationssaal durfte ich bei einem Kaiserschnitt dabei sein. Und das ging alles soo schnell. Das Baby war nur ein paar Minuten nach dem Hautschnitt geboren und damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Es war einfach so schön und ich konnte meine Tränen nicht zurückhalten. Ab dem zweiten Tag war ich einen Schritt weiter, ich durfte mit an den OP-Tisch. Voller Begeisterung und Motivation stand ich steril an der rechten Seite des Bauches. Zum ersten Mal durfte ich zwei Haken halten und mithelfen. Das war ein sehr schönes Gefühl.
Ich war richtig gespannt darauf die erste natürliche Geburt zu sehen. Doch so schnell ging das nicht, da die meisten Babys bekanntlich nachts zur Welt kommen. Beim ersten Mal überhaupt in einem Operationssaal durfte ich bei einem Kaiserschnitt dabei sein. Und das ging alles soo schnell. Das Baby war nur ein paar Minuten nach dem Hautschnitt geboren und damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Es war einfach so schön und ich konnte meine Tränen nicht zurückhalten. Ab dem zweiten Tag war ich einen Schritt weiter, ich durfte mit an den OP-Tisch. Voller Begeisterung und Motivation stand ich steril an der rechten Seite des Bauches. Zum ersten Mal durfte ich zwei Haken halten und mithelfen. Das war ein sehr schönes Gefühl.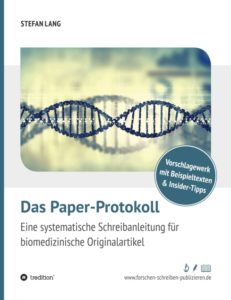 Die Veröffentlichung der Ergebnisse in einem Fachmagazin steht sowohl in der Medizin als auch in den meisten anderen Naturwissenschaften am Ende eines jeden Forschungsprojekts. Auch bei den anschaulichsten Studien kann das schlussendliche Paper dem Verfasser den letzten Nerv rauben. „Das Paper-Protokoll“ zeigt eine einfache Vorgehensweise auf, um in 4 verschiedenen Phasen zu einem Endprodukt zu gelangen, das den wissenschaftlichen Ergebnissen den adäquaten Rahmen gibt.
Die Veröffentlichung der Ergebnisse in einem Fachmagazin steht sowohl in der Medizin als auch in den meisten anderen Naturwissenschaften am Ende eines jeden Forschungsprojekts. Auch bei den anschaulichsten Studien kann das schlussendliche Paper dem Verfasser den letzten Nerv rauben. „Das Paper-Protokoll“ zeigt eine einfache Vorgehensweise auf, um in 4 verschiedenen Phasen zu einem Endprodukt zu gelangen, das den wissenschaftlichen Ergebnissen den adäquaten Rahmen gibt.