OSCEs oder „Objective structured clinical examinations“ sind für viele der Medizinstudenten ein fester Bestandteil des Curriculums und immer wieder ein Grund für Herzrasen, Schweißausbrüche, leichte Übelkeit, also kurz: milde Panikattacken.
Zunächst einmal zur Begriffserklärung. Die OSCEs gehören zum praktischen Teil der medizinischen Ausbildung und sind zwar ein Schreckgespenst, aber im Nachhinein betrachtet doch ein sehr hilfreicher Aspekt der medizinischen Ausbildung im klinischen Studienabschnitt. In einem festen zeitlichen Rahmen werden Fähigkeiten, wie z.B. die gezielte Anamneseerhebung oder klinische Untersuchung, das Legen einer Nadel oder auch die Reanimation geprüft.
 Meist gibt es in jedem wichtigen klinischen Fach ein OSCE, der aus mehreren Stationen mit verschiedensten Aufgabenstellungen besteht, für die man jeweils eine vorgegebene Zeit zum Bearbeiten hat, meist 5-10 Minuten. Die Station ist mit Simulationspatienten oder Puppen, bzw. Simulationsgeräten (z.B. einem Arm zum Blutabnehmen) ausgestattet. Jede Station wird von einem Prüfer überwacht, der auch die Punkte vergibt. Dafür gibt es einen standardisierten Bogen, daher auch das Wörtchen „objective“. Jeder Student hat dieselben Stationen, Prüfer und Bewertungsbögen: Somit ist die Note zumindest einigermaßen fair.
Meist gibt es in jedem wichtigen klinischen Fach ein OSCE, der aus mehreren Stationen mit verschiedensten Aufgabenstellungen besteht, für die man jeweils eine vorgegebene Zeit zum Bearbeiten hat, meist 5-10 Minuten. Die Station ist mit Simulationspatienten oder Puppen, bzw. Simulationsgeräten (z.B. einem Arm zum Blutabnehmen) ausgestattet. Jede Station wird von einem Prüfer überwacht, der auch die Punkte vergibt. Dafür gibt es einen standardisierten Bogen, daher auch das Wörtchen „objective“. Jeder Student hat dieselben Stationen, Prüfer und Bewertungsbögen: Somit ist die Note zumindest einigermaßen fair.
Klingt eigentlich alles wie eine bessere Schnitzeljagd mit spannenden Aufgaben zum Lösen, ist aber meist doch nicht so lustig, da man unter enormem Zeitdruck steht und um eine möglichst hohe Punktzahl zu erzielen, ziemlich genau die gewünschten Angaben auf den Bewertungsbögen abhaken muss.
Wie bereitet man sich nun auf so eine Prüfung vor? Am besten: üben, üben, üben. Die Abläufe der Untersuchung so lange wiederholen, durchführen und aufsagen, bis man sie im Schlaf kann, denn unter Zeitdruck passieren die dümmsten Dinge! In kleinen Gruppen kann man sich gut gegenseitig untersuchen und verbessern. Die meisten Unis stellen auch einige Aufgabenstellungen inklusive Bewertungsbögen zur Verfügung und wenn nicht, fragt in den älteren Semestern nach, ob es Gedächtnisprotokolle gibt!
So lästig und nervenaufreibend die OSCEs auch sind – sie zwingen zu einer intensiven Beschäftigung mit den Basisfähigkeiten, die man während des Studiums erlernen sollte.
Bild: Praisaeng / FreeDigitalPhotos.net
 Das Darm-Mikrobiom – die Gesamtheit aller Mikroorganismen im Darm, die fast ausschließlich aus Bakterien besteht – spielt eine entscheidende Rolle für unsere Gesundheit. In den letzten Jahren haben Wissenschaftler entdeckt, dass die Darmbakterien weit über die Verdauung hinaus Einfluss auf verschiedene Aspekte unserer körperlichen und geistigen Gesundheit nehmen. Eine faszinierende und noch relativ junge Forschungsrichtung beschäftigt sich mit der Frage, wie das Darm-Mikrobiom unser Lernvermögen beeinflusst.
Das Darm-Mikrobiom – die Gesamtheit aller Mikroorganismen im Darm, die fast ausschließlich aus Bakterien besteht – spielt eine entscheidende Rolle für unsere Gesundheit. In den letzten Jahren haben Wissenschaftler entdeckt, dass die Darmbakterien weit über die Verdauung hinaus Einfluss auf verschiedene Aspekte unserer körperlichen und geistigen Gesundheit nehmen. Eine faszinierende und noch relativ junge Forschungsrichtung beschäftigt sich mit der Frage, wie das Darm-Mikrobiom unser Lernvermögen beeinflusst.
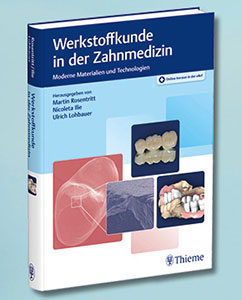 Nach langer Zeit hat Thieme wieder ein Buch zur Werkstoffkunde herausgebracht. Das von Studenten meist eher als trocken empfundene Fach soll hier praxisnah und anwendungsorientiert aufgearbeitet werden. Ob Thieme diesem Versprechen gerecht wird, haben wir getestet.
Nach langer Zeit hat Thieme wieder ein Buch zur Werkstoffkunde herausgebracht. Das von Studenten meist eher als trocken empfundene Fach soll hier praxisnah und anwendungsorientiert aufgearbeitet werden. Ob Thieme diesem Versprechen gerecht wird, haben wir getestet.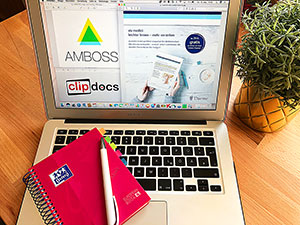 Ihr bekommt bei Amboss jegliche Fakten stichpunktartig und mit Bildern und Tabellen untermauert präsentiert. Dabei kann man auch entscheiden, ob tiefergehende Fakten eingeblendet werden sollen oder nicht. Außerdem sind alle Amboss-Artikel untereinander verlinkt – so kannst du dir nach Bedarf nicht nur das vorklinische Grundlagenwissen aneignen, sondern auch in Krankheitsbildern und Therapien stöbern. Ihr filtert also selbst, ob ihr tief ihr in die Materie einsteigen wollt oder ob euch für Klausuren und Examen erstmal das Basiswissen reicht.
Ihr bekommt bei Amboss jegliche Fakten stichpunktartig und mit Bildern und Tabellen untermauert präsentiert. Dabei kann man auch entscheiden, ob tiefergehende Fakten eingeblendet werden sollen oder nicht. Außerdem sind alle Amboss-Artikel untereinander verlinkt – so kannst du dir nach Bedarf nicht nur das vorklinische Grundlagenwissen aneignen, sondern auch in Krankheitsbildern und Therapien stöbern. Ihr filtert also selbst, ob ihr tief ihr in die Materie einsteigen wollt oder ob euch für Klausuren und Examen erstmal das Basiswissen reicht.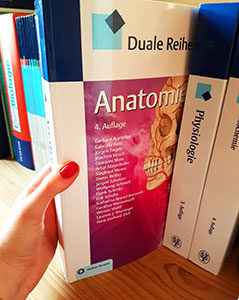 Das richtige Lehrbuch
Das richtige Lehrbuch Meist gibt es in jedem wichtigen klinischen Fach ein OSCE, der aus mehreren Stationen mit verschiedensten Aufgabenstellungen besteht, für die man jeweils eine vorgegebene Zeit zum Bearbeiten hat, meist 5-10 Minuten. Die Station ist mit Simulationspatienten oder Puppen, bzw. Simulationsgeräten (z.B. einem Arm zum Blutabnehmen) ausgestattet. Jede Station wird von einem Prüfer überwacht, der auch die Punkte vergibt. Dafür gibt es einen standardisierten Bogen, daher auch das Wörtchen „objective“. Jeder Student hat dieselben Stationen, Prüfer und Bewertungsbögen: Somit ist die Note zumindest einigermaßen fair.
Meist gibt es in jedem wichtigen klinischen Fach ein OSCE, der aus mehreren Stationen mit verschiedensten Aufgabenstellungen besteht, für die man jeweils eine vorgegebene Zeit zum Bearbeiten hat, meist 5-10 Minuten. Die Station ist mit Simulationspatienten oder Puppen, bzw. Simulationsgeräten (z.B. einem Arm zum Blutabnehmen) ausgestattet. Jede Station wird von einem Prüfer überwacht, der auch die Punkte vergibt. Dafür gibt es einen standardisierten Bogen, daher auch das Wörtchen „objective“. Jeder Student hat dieselben Stationen, Prüfer und Bewertungsbögen: Somit ist die Note zumindest einigermaßen fair. Wir sind aus der Schulzeit gewohnt, den Großteil des Stoffes sicher zu beherrschen, die Zeit reicht auch für die kleineren Details aus und man geht mit einem guten Gefühl in die Klausur. Nicht so in der Medizin: die Zeit ist immer knapp, die Bücher zu dick und das Hirn schier wie ein Sieb. Als ich die Medi-Learn-Heftchen in der Vorklinik entdeckte (inzwischen gibt es ja auch die Endspurt-Skripte), ging es mir wie einem Durstigen, der einen Brunnen in der Wüste fand. Das, was ich mir bis dahin immer mühevoll aus Büchern herausschreiben musste, stand alles dort drin. Eselsbrücken, besonders gern gefragte Dinge und kleine Tipps und Tricks – kurzum, ich war begeistert und ignorierte die kleine Stimme, die mir ins Ohr flüsterte, dass die Heftchen doch viel zu dünn wären, im Vergleich zu den Lehrbüchern.
Wir sind aus der Schulzeit gewohnt, den Großteil des Stoffes sicher zu beherrschen, die Zeit reicht auch für die kleineren Details aus und man geht mit einem guten Gefühl in die Klausur. Nicht so in der Medizin: die Zeit ist immer knapp, die Bücher zu dick und das Hirn schier wie ein Sieb. Als ich die Medi-Learn-Heftchen in der Vorklinik entdeckte (inzwischen gibt es ja auch die Endspurt-Skripte), ging es mir wie einem Durstigen, der einen Brunnen in der Wüste fand. Das, was ich mir bis dahin immer mühevoll aus Büchern herausschreiben musste, stand alles dort drin. Eselsbrücken, besonders gern gefragte Dinge und kleine Tipps und Tricks – kurzum, ich war begeistert und ignorierte die kleine Stimme, die mir ins Ohr flüsterte, dass die Heftchen doch viel zu dünn wären, im Vergleich zu den Lehrbüchern.